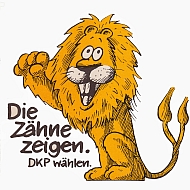Glashüttenbrache als neue Alternative in der Wohnungspolitik
CDU, SPD und FDP: Retter der Kapitalinteressen
Im Frühjahr und Sommer 2005, als die Gerresheimer Glashütte vor der Zerschlagung durch den Weltkonzern Owens Illinois (O‑I) aus Perrysburg (US-Bundesstand Ohio) stand, wurden am Tor zur Hütte Funken von Klassenkampf sichtbar. An den Glaswannen und Glasmaschinen hatten die hochspezialisierten Glasmacher den Betrieb zum größten Flaschenproduzenten der Welt hochgeblasen. Die Belegschaft war hochgradig organisiert. In der IG Chemie.
Hochgradig organisiert waren auch die Kapitalinteressen. Bei den Aktionärsversammlungen in der Düsseldorfer Messe wurden Vorstand und Aufsichtsrat nahezu regelmäßig wegen der «Ergebnisse» gefeiert. Nur ab und an kritische Anmerkungen von der Vereinigung der Kleinaktionäre, allerdings ohne das Gesamtsystem in Frage zu stellen.
Nur einmal gab es schroffe Ablehnung. Die DKP hatte für Peanuts ein paar Aktien gekauft, nicht um Aktionär wegen einer erwarteten Dividende zu werden, sondern um überhaupt Zugang zur Aktionärsversammlung zu bekommen. Aktionäre und Geschäftsleitung tagten ja nicht öffentlich. In die Halle durfte nur, wer sich als Aktionär ausweisen konnte. Immer dabei: Security und kleinste Taschen mit kleinen Give aways für die Kleinstaktionäre. Sie durften sich umworben fühlen. Zustimmung erreicht der Weltkonzern wohl nicht nur durch die steigenden Kurven auf dem Börsenbarometer. Da mag auch ein Kugelschreiber mit Firmenlogo oder ein Briefblock, ebenfalls mit dem Aufdruck des Firmensignets, identitätsstiftend wirken.
Dividende, Geschenke und die Ideologie von «Familie Gerresheim», bei der die Kleinen bekanntlich mit den Großen zusammen in einem Boot sitzen dürfen, brachten bei der Entlastung des Vorstandes Ergebnisse, die stets Richtung 100 Prozent gingen. Umgekehrt stieß ein Antrag der DKP auf nahezu 100prozentige Ablehnung. Gefordert war, den Vorstand nicht zu entlasten, weil der sich geweigert hatte, die Zwangsarbeiter aus der Zeit des 2. Weltkrieges zu entschädigen. Die Gewinne hätten diese Peanuts ausgehalten. Bei anderen Großkonzernen ging das ja auch. In der Messehalle flaute der Wind nicht ab: Kein Geld für Zwangsarbeiter!
Dabei hätten sich die Herren Aktionäre wenigstens eine Imagination von den Zwangsarbeitern verschaffen können. Das «Russenlager» lag genau gegenüber vom heutigen BAUHAUS, dort wo «Nach den Mauresköthen» von der Torfbruchstraße abzweigt. Ein anderes Bild wäre auch möglich: das sowjetische Gräberfeld für 450 Sowjets im Gerresheimer Waldfriedhof. Oder die 1.500 Toten auf dem «Ehrenfriedhof» an der Blanckertzstraße. Aber es wurde in der Messehalle wie später vor dem Tor der Hütte an der Heyestraße bestätigt: Der Kapitalismus geht über Leichen
O‑I konnte das Schicksal der Glasmacher am Arsch vorbei gehen, wie damals ein Betroffener voller Wut feststellte. Der Konzern produziert ohnehin jede zweite Glasflasche auf der Welt. Was kratzt da Gerresheim, arbeitslose Glasmacher, verarmende Familien, Jugendliche ohne Ausbildungsplatz. Und das vor dem Hintergrund, dass in Gerresheim keine roten Zahlen notiert wurden. Es gab Gewinne. Die waren aber wohl nicht hoch genug.
O‑I hatte bei diesem Ansatz von Klassenkampf nicht nur dividendeheischende Claqueure , sondern auch Helfer. Als Vertreter des Betriebsrates, Mitglieder der Initiative «Rettet die Glashütte», darunter die DKP, und viele Kollegen ins Düsseldorfer Rathaus eindrangen, um dem damaligen Oberbürgermeister Joachim Erwin (CDU) Protestunterschriften mit der Forderung zu überreichen, er solle solidarisch für die Glasmacher aktiv werden, da hatte er wohl einen aus der DKP erkannt. Er warnte außerordentlich scharf, die Kollegen sollten nicht den «Rattenfängern»(!) folgen. Das sei nicht gut für weitere Verhandlungen mit O‑I. In Gerresheim hat er sich den Kolleginnen und Kollegen nie in einer Diskussion gestellt. Die geschmeidigen Gespräche über die Sicherung von Kapitalinteressen bedürfen der Verschwiegenheit. Auch aus der SPD und der IG Chemie kamen Hinweise, man solle keine Illusionen verbreiten. Krokodilstränen im Gerresheimer Rathaus von CDU, FDP und SPD. Parlamentarischer Aufstand geht anders. Fazit vor zwölf Jahren: Einem Weltkonzern pisst man nicht auf die Schuhe.
Wie sind die Gerresheimer doch veralbert worden. Die Stadt Düsseldorf war wenigstens Mitwisser, als die Industriebrache neuen Kapitalinteressen dienstbar gemacht werden sollte: Die DKP hatte gefordert, wenigstens alternative Produktion zu überprüfen, um Arbeitsplätze zu sichern. Glasfaserkabel wurden weltweit gefragt. Wohnungsbau bringt bei steigender Wohnungsnot allerdings den höchsten Profit mit steigender Tendenz. Auch da gibt es wie bei «Monopoly» verschiedene Strategien: Hochpreisige Angebote oder Verdichtung mit mehr Wohneinheiten auf gleichgroßer Fläche. Und das alles verpackt in scheinhaft demokratischer Transparenz.
Käufer der 200.000 qm war die Patrizia AG aus Augsburg, die sich seit 30 Jahren im institutionellen Immobilien-Investment engagiert. Die restlichen 100.000 qm gingen an die Stadt Düsseldorf. Dieses letzte Drittel liegt, wenn man draufschaut, rechts vom Transformatorenhaus an «Mauresköthen». Zwischenzeitlich sind auch hier die restlichen Hallen abgerissen worden.
Ende Juni platzte nun die Blase. Patrizia hört auf. Alles hat nicht funktioniert: Die Arbeiten an Straßen, Wegen, Anlagen sollten 2015 beginnen. Wenn man durch die Fenster im Bauzaun blickt, stellt man fest: Nichts davon ist fertig. 2016 sollte mit den Bauarbeiten für 1400 Wohneinheiten begonnen werden. Keine einzige Wohneinheit ist fertig. Für das gesamte Projekt wird mit einer Investitionssumme von einer Milliarde Euro gerechnet.
Diese Milliarde sollte, so ist das im Kapitalismus, neues Geld «machen». Das geht aber nur, wenn das Geld auch «arbeiten» kann. Da gab es über Jahre ein paar Probleme. Ein Problem, das vermutlich von Patrizia falsch eingeschätzt wurde, ist der Baugrund. Wohl kaum ein Baugrundstück ist in Düsseldorf so stark kontaminiert wie der Boden der Glashütte. Nun wird seit Monaten «saniert». Sandberge werden ausgehoben und von A nach B verlagert. Toxische Anteile werden abtransportiert. Das kostet. Das dauert.
Auch die «Spielwiesen der Demokratie», die Werkstattverfahren, haben verzögert, haben gekostet. Da wurden renommierte Architekturbüros eingeladen, die ihre Vorstellungen coram publico vortragen und erläutern durften. Die Modelle sahen so schön aus. Die Pläne waren so bunt. Einer wie der andere. Alle Besucher durften Vorschläge machen und sich eine kurze Weile freuen.
Gleich beim ersten Werkstattverfahren wurde aber auch deutlich, dass es nicht nur um Bauen geht. Es ging auch darum, den Verkehr autokompatibel zu halten. Baudezernent Dr. Gregor Bonin wurde in der Kantine der Glashütte zur leisen, aber bestimmenden Flüstertüte seines Herrn, OB Erwin. Er sagte den Architekten, dass diejenigen von ihnen, die in ihrer Planung nicht die von Erwin gewünschte «Stadtautobahn», parallel zur Bundesbahnstrecke, berücksichtigen würden, gleich nach Hause gehen könnten. Erwins conditio sine qua non wurde unter seinem Nachfolger Elbers langsam zur Nullnummer.
Für die Strecke der Straßenbahn von der Innenstadt zum Gerresheimer Bahnhof wurde der Trassenverlauf mehrfach verzögernd und kontrovers beraten. Dieser Vorgang soll ein Jahr an Zeit gekostet haben. Und Geld.
Über die Preise und die Mieten für die Wohnungen gab es keine Modellrechnungen und keine Farbprospekte. Die DKP forderte «bezahlbares Wohnen». Diese Forderung wurde wohl nicht einmal in die «Wunschliste» aufgenommen. Stimmt nicht ganz. Niedriger preisige Wohnungsblocks wurden zwar in die Planung aufgenommen, aber natürlich zu dem Preis, dass ihre zukünftigen Bewohner direkt an der Bahnlinie wohnen sollten.
«Watt nu?», wie die Hötter in Anlehnung an das Platt in Untergerresheim fragen könnten.
Patrizia möchte ganz systemimmanent bleiben und verkaufen. Gesucht wird ein Investor, der übernimmt und so stark sein muss, dass er die bisherigen Verluste, die nicht veröffentlicht wurden, stemmen kann. Gut so, sagt CDU-Ratsherr Andreas Hartnigk (CDU) in der RP. Das würde sich schon rechnen, meint er. Denn die Baupreise würden ja steigen. Über die neuen Mitpreise sagt er nichts. Patrizia verwies auf das Düsseldorfer »Handlungskonzept Wohnen», das partielle Mietsenkungen ermöglicht.
Auch Martin Volkenrath (SPD) geht davon aus, dass die Dinge ihren Lauf nehmen, wenn denn ein neuer Eigentümer gefunden worden sei. Dass vielleicht die Stadt Düsseldorf auf gemeinnütziger Basis ins Geschäft einsteigen könnte, hört man von dem Sozialdemokraten nicht.
Ein neuer Investor könne neue Forderungen stellen. Da müsse man flexibel reagieren, sagt Ex-Bürgermeisterin Marie-Agnes-Strack-Zimmermann (FDP). Im Unterschied zu SPD und CDU bringt sie als Stichwort die städtische IDR (Industrie-Terrain Düsseldorf-Reisholz) als mögliche Käuferin ins Gespräch, sieht die Gesellschaft aber überfordert. Die Grünen sind da schon optimistischer, wenn sie auch schon einen Weiterverkauf im Auge haben.
Nach Auffassung der Gerresheimer DKP hat die Stadt jetzt die einmalige Chance einzusteigen und damit einen Meilenstein für «Mehr Gerechtigkeit!» zu setzen: Die Mieten könnten unter städtischer Regie so bestimmt werden, dass die Mietrechnung wirklich für alle bezahlbar wäre, und die Wohnungen wären aus dem kapitalistischen Verwertungssystem herausgebrochen. Und Versicherungen, Staatsfonds und Sparkassen müssten ihre Kontakte zu Patrizia neu justieren.
Text: Uwe Koopmann
Fotos: Bettina Ohnesorge